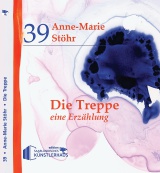Gerhard Tänzer
Geboren 1937 in Nordhausen (Thüringen) wechselte er 1955 in die Bundesrepublik und kam 1967 ins Saarland, wo er bis 2000 als Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte in Saarlouis arbeitete.
1979 debütierte er mit Lyrik (Hier und anderswo), seiner favorisierten literarischen Gattung, später verfasste er auch Theaterstücke und eine literarische Versschule (Schönes Blumenfeld) sowie autobiografische Texte (Himmelbrand). Er hat sich auch für das Saarland literarisch engagiert: 2003 schrieb er z. B. den seither gültigen Text der offiziellen Landeshymne, des Saarlandliedes: Ich rühm' dich, du freundliches Land an der Saar | von friedlichen Grenzen umgeben...
1999 erhielt er den Kulturpreis für Kunst und Wissenschaft des Landkreises Saarlouis.
Gerhard Tänzer starb am 12. August 2025 im Alter von 88 Jahren in Saarlouis an den Folgen eines Herzinfarkts.
Ralph Schock erinnert an ihn:
Lieber Gerhard,
so habe ich Dich in unserer Korrespondenz immer angeredet. Zuerst in Briefen, später in Mails. Von Anfang an. Nie haben wir uns gesiezt. Denn wir waren Kollegen im Schriftstellerverband. Und da siezt man sich nicht, egal, wie groß der Altersunterschied auch sein mag.
Vor fast 50 Jahren trafen wir uns zum ersten Mal. Dass Du Dich an diese Begegnung viele Jahre später noch ebenso genau erinnert hast wie ich, das weiß ich aus einer Bemerkung von Dir bei einem unserer letzten Treffen.
Du hattest damals, im Spätsommer 1978, Dein erstes Manuskript fertiggestellt, den Gedichtband „Hier und anderswo“, der ein Jahr später erschienen ist. Der saarländische Schriftstellerverband hatte damals gerade die Edition einer eigenen Buchreihe gestartet. Du warst einer der ersten, der Texte einschickte. Und obwohl wir uns bis dahin nur ein paar Mal im Jour fix des Verbands unterhalten hatten, fragtest Du mich, ob ich Dein Manuskript durchsehen wolle. Durch diese Bitte fühlte ich mich sehr geehrt.
An die damalige Lektoratsarbeit kann ich mich noch genau erinnern. Gab es wegen einer Wendung, einem poetischen Bild oder einer formalen Idee Einwände oder auch nur Fragen von mir, so fandest Du Argumente, um Deine Fassung zu verteidigen. Zunächst. Doch oft kamst Du schon ein paar Minuten später darauf zurück und räumtest ein, dass eine Metapher vielleicht doch nicht optimal gewählt oder ein poetisches Bild nicht konsequent entwickelt war. Dann beugtest Du Dich über solche Stellen und begannst, zu erwägen, was dafür und was dagegen sprach – und ob es vielleicht eine noch bessere Formulierung geben könnte.
Aber – und das zeigt den klugen Autor – Du legtest Dich nicht gleich fest auf eine neue Fassung. So sehr sie Dir auch gefallen mochte. Du bliebst zunächst skeptisch. Aber notiertest alles, meine Einwände und Deine neue Ideen. Und zwar mit einem Bleistiftstummel in Deinen kleinen eckigen Buchstaben auf dem entsprechenden Blatt. Nach etwa zwei Wochen schicktest Du mir die endgültige Fassung, die dann so in Druck ging.
Wie wichtig Dir diese frühen Gedichte gewesen sind, kann man daran erkennen, dass Du achtzehn Texte daraus zwanzig Jahre später in den Band „Das Land vor Augen“ erneut aufgenommen hast.
So wie bei Deinem ersten Buch haben wir auch später noch oft zusammengearbeitet. Nicht selten kamst Du dafür an den Funk auf dem Halberg. Im Gepäck die literarische Ernte aus den Ferienwochen in eurem wunderbaren Haus am Atlantik. Dort hattest Du die während des Schuljahres notierten Einfälle durchgesehen und in eine vorläufige literarische Form gebracht. Und dann warst Du neugierig auf die Resonanz eines Lesers. Doch wie immer hörtest Du Dir Zustimmung wie Einwände kommentarlos an. Und vor einer Antwort hast Du erstmal nachdenklich eine Zigarette aus der Packung gefischt, um sie dann, eine Weile zwischen den Fingern drehend, bevor Du sie angezündet hast, genüsslich niederzurauchen.
In Deinen Texten dominierten lebenslang drei Themenbereiche, die sich auch regional fassen lassen: Aquitanien, das Saarland, und schließlich Thüringen und die DDR, also Texte über Deine Kindheit und Jugend.
So erzähltest Du einmal auf der Terrasse der SR-Kantine - wo wir uns meistens trafen, denn dort störten keine Telefonanrufe - , dass man Dich eines Tages ins FDJ-Zimmer Deines Gymnasiums in Nordhausen vorgeladen hatte. Direktor und Partei verlangten von Dir und nötigten Dich geradezu, eine Stellungnahme der Schule gegen zwei Mitschüler von der regimekritischen protestantischen „jungen Gemeinde“ zu unterschreiben. Du, damals noch Katholik, hast Dich geweigert zu unterschreiben und dem Druck widerstanden. Wenn auch, wie Du einräumtest, „unter Tränen“.
Du hast damals auch von Deiner Arbeit nach dem Abitur erzählt. Von zwei Monaten im Schlamm, im Dreck und Staub in einem Kalibergwerk. Und von den Kipploren, die plötzlich aus der Finsternis heranschossen und irgendwohin weiterrollten. Und von jener Lore, die Dich ums Haar zerquetscht hätte.
Du erzähltest auch, weil man Dich nicht studieren ließ, von Deiner Ausreise in den Westen 1955.
Thüringen- und Harz-Reminiszenzen finden wir in den Bänden „Hier und anderswo“, auch in „Fischer, wie hoch ist das Wasser? – Gedichte und Bilder zu einer Kindheit und Jugend“. Deiner Herkunft verdanken wir auch die neuhochdeutsche Übertragung von drei mittelalterlichen thüringischen Minnedichtern. Der Band ist 2005 unter dem Titel „Frouwe, Frouwe, Frouwe mîn“ herausgekommen.
Über den 2012 erschienenen Band „Himmelbrand - Erinnerungen einer Kindheit und Jugend“ haben wir am Sender ein langes Gespräch geführt. Du wolltest erst nicht. Wie so oft, wenn Du zu Lesungen eingeladen warst. Aber schließlich hast Du doch zugestimmt. Weil Du das Mikrofon und die Aufnahmesituation ein wenig gescheut hast, empfing ich Dich mit einer guten Flasche Rotwein, den wir zuerst in meinem Büro und dann auch während der Aufnahme im Studio tranken. So wurde es ein zwar lockeres, aber auch ernstes Gespräch, mit dem Du sehr zufrieden warst.
Dein zweiter thematischer Schwerpunkt war das Saarland. Neben einer Reihe von Gelegenheitsgedichten sind vor allem zwei einschlägige Veröffentlichungen zu nennen. Die frühbarocken Gedichte des 1573 im saarländischen Limbach geborenen Lyrikers Theobald Hock, die Du, zusammen mit Bernd Philippi, ins Neuhochdeutsche übertragen hast.
Und als 2003 das saarländische Kultusministerium einen Wettbewerb ausschrieb für eine neue offizielle Saarland-Hymne, da hast Du einen Text eingereicht - und gewonnen. Die erste von drei Strophen lautet:
Ich rühm’ dich, du freundliches Land an der Saar,
von friedlichen Grenzen umgeben.
Nie wieder bedrohe dich Krieg und Gefahr,
in dir möcht’ ich immerzu leben.
Und gibst du uns Arbeit, so hat’s keine Not,
wir werden die Mühen nicht scheuen,
und Feste auch feiern zum täglichen Brot,
denn du, unser Land, sollst uns freuen.
Dem damaligen Kultusminister hat das Lied nicht gefallen. Es war ihm zu wenig optimistisch. Er lud Dich deshalb ins Ministerium ein. Genauer: Er lud Dich vor mit dem Ansinnen, dass Du den Text ändern solltest. Aber auch in diesem Fall hast Du Dich geweigert. Unter anderem mit dem Argument, die schöne Wendung „Auferstanden aus Ruinen!“ sei ja schon vergeben.
In der Zeit als Lehrer hast Du mindestens zwei Deiner ehemaligen Schüler mit Deiner Begeisterung für Literatur anstecken können. Eine Schülerin hat in einem renommierten saarländischen Verlag einen Lyrikband herausgebracht. Und ein anderer, Raimund Fellinger, machte Karriere als Cheflektor in dem damals wohl angesehensten Verlag Deutschlands, dem Suhrkamp-Verlag. Als ich Dich einmal fragte, ob Du Fellinger nicht Texte von Dir schicken wolltest für vielleicht ein kleines Bändchen der Reihe „edition suhrkamp“, da hast Du dieses Ansinnen beinahe brüsk zurückgewiesen mit den Worten „Das macht man nicht!“
Deinem dritten Thema hast Du für eine Reihe von Texten den Titel gegeben: „Aquitanische Reise“. Denn dorthin, in die wunderbare Landschaft des Départements Gironde, bist Du mit Deiner aus Bordeaux stammenden Lebensgefährtin Janine jahrzehntelang gefahren. Um Dich von der Schule zu erholen. Und um die guten, von Janine zubereiteten Speisen zu genießen – nicht zu vergessen die Weine aus dem Bordelais. Aber auch, um dort zu schreiben.
In dem erwähnten Zyklus „Aquitanische Reise“ bringst Du in einem kurzen Gedicht beide Regionen, die Deiner Herkunft und die Deiner Sommermonate, fast exemplarisch auf den Punkt. Es heißt:
AN DER DORDOGNE
Hier heißen die Orte,
weinbergumkränzt,
Pain-de-Sucre und Lustre,
in meiner Heimat im Harz
unter den Fichten
Elend und Sorge.
Deine auflagenstärkste Veröffentlichung war die „kleine erotische Versschule“, so der Untertitel des Bandes „Schönes Blumenfeld“, eine Titelübernahme von dem Barockdichter Theobald Hock. Der Band ist 1985 in der Pfälzischen Verlagsanstalt erschienen. Doch die Lektoren des bekannten S. Fischer-Verlags in Frankfurt haben den wunderbaren Band entdeckt und in ihr Taschenbuchprogramm übernommen. So wurdest Du deutschlandweit bekannt. In diesem Büchlein hast Du Deine germanistische und Deine poetische Kompetenz aufs Allervergnüglichste zusammengebracht. Ausschließlich an und mit erotischen Texten hast Du die eigentlich trockene Materie von Metrik und Reim demonstriert und erklärt: Zum Beispiel den Alexandriner und den Spondeus, Terzine und alkäische Ode, Rondell und Madrigal, Haiku und Klapphornvers, Elegie und Epigramm, auch den Kreuz-, Schweif-, Klammer-, Ketten- und Schüttelreim und weitere Begriffe aus der Verslehre.
Die beiden Hörspiele von Dir produzierte der Saarländische Rundfunk. Die Uraufführungen Deiner drei Theaterstücke fanden in Bayreuth statt. Ausgezeichnet wurdest Du 1984 mit dem Bayreuther Theaterpreis und 1999 mit dem Kulturpreis für Kunst und Wissenschaft des Landkreises Saarlouis.
Dein vermutlich längstes Gedicht hat einen Umfang von sieben Seiten. Es steht ziemlich weit vorne in Deinem Debütband „Hier und anderswo“ und trägt den Titel „Gedicht auf die Geburt meines Sohnes“. Am Schluss heißt es:
Lieder
habe ich lange nicht mehr gelernt, ich werde dir
ein wenig sagen können
von der Kunst des Überlebens
und ich weiß,
das genügt nicht.
Unvergesslich ist mir in diesem Zusammenhang eine kleine Geschichte über Deinen Sohn Guillem. Als er etwa vier oder fünf Jahre alt war und anfangen wollte zu schreiben, so wie sein Vater und seine Mutter es taten, da griff er in einem offenbar unbeobachteten Moment zu Deinem Füllfederhalter. Und drückte das teure Schreibgerät vor lauter energischem Wollen offenbar so fest auf das Papier, dass sich die Feder verbog.
Ich weiß nicht, ob diese Geschichte in einem Deiner Texte je Eingang gefunden hat. Aber für Dich war sie offenbar eine so schöne wie unvergessliche Erinnerung an Deinen Sohn, denn Du hast sie mir zwei- oder dreimal erzählt.
Lieber Gerhard, „Hier und anderswo“, so lautet der Titel Deiner ersten Veröffentlichung. „Hier“ bei uns, bei Deiner Frau, Deinem Sohn, Deinen Verwandten, Freunden und Kollegen, bist du glücklicherweise sehr lange gewesen.
„Anderswo“ bist Du jetzt.
Wir verneigen uns vor Dir, Deiner Kunst und Deinem Leben.